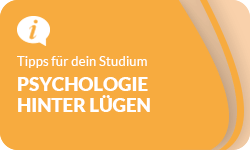
Jeder Mensch lügt! Dieser Satz mag etwas hart klingen, doch psychologische Studien haben schon lange bestätigt, dass Unwahrheiten ein unausweichlicher Teil unseres sozialen Miteinanders sind. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um die kleine Notlüge, das taktische Schweigen oder die handfeste Täuschung handelt.
Im akademischen Kontext haben Lügen zumeist schwerwiegende Folgen, daher gilt als Tipp im Studium, stets von Lügen und Täuschungsversuchen abzusehen. Aufgrund der modernen Technik liegen zwischen der akademischen Integrität und der Versuchung, zu schummeln oder abzukupfern, nur wenige Klicks. Doch was steckt eigentlich hinter dem Lügen und wie funktioniert es? Könnte ein Lügendetektor sogar an einer Hochschule eine Rolle spielen?
Das Lügen und seine Psychologie
Lügen ist alles andere als einfach. Aus kognitiver Sicht ist es sogar relativ anspruchsvoll. Das liegt daran, dass das Hirn vergleichsweise einfach auf die Wahrheit zugreift, das Lügen hingegen mehrere Prozesse gleichzeitig benötigt.
Eine erfundene Aussage ist konstruiert, sie muss im Gehirn behalten und konsistent präsentiert werden. Gleichzeitig muss die echte Erinnerung, also die Wahrheit, unterdrückt werden. Dieser Mehraufwand ist es, der den Lügner entlarvt. Obwohl es der Lügner vielleicht selbst nicht bemerkt, zeigt der Körper beim Lügen eine Reaktion. So zeigt sich zumeist der Herzschlag beschleunigt und die Atmung verändert.
In der Psychologie steht fest, dass eine Lüge in den meisten Fällen dem Selbstschutz, einem möglichen sozialen Vorteil oder der Vermeidung einer Strafe dient. Studierende, bei denen der Verdacht auf ein Plagiat im Raum steht, verteidigen sich oftmals mit Aussagen, die die Schwere der Tat herunterspielen. Dabei handelt es sich um eine kognitive Dissonanzreduktion. Automatisch wird das Fehlverhalten umgedeutet, um sich nicht schlecht fühlen zu müssen.
Der Lügendetektor – wo ist er theoretisch sinnvoll?
Im universitären Alltag lassen sich immer wieder theoretische Szenarien finden, in denen der Lügendetektor, auch Polygraph genannt, zur Klärung beitragen kann. Denkbar sind ein Streit um die Urheberschaft bei einer Gruppenarbeit oder der Vorwurf manipulierter Daten im Rahmen einer Forschungsarbeit. Sogar bei einem Prüfungsbetrug, wenn der Verdacht auf die Weitergabe von Lösungen besteht, könnte ein polygraphischer Test in Betracht gezogen werden.
In der Realität ist der Einsatz eines Polygraphen allerdings mit erheblichen ethischen Fragen verbunden. Es steht im Raum, ob das Gerät ein legitimes Mittel zur Wahrheitsfindung ist und ob es den Eingriff in die Persönlichkeitsrechte rechtfertigt. Universitäten bedienen sich stattdessen technischer Hilfsmittel, wie einer Plagiatssoftware wie der Plagiatsprüfung von BachelorPrint, um mögliche Verstöße in einem verhältnismäßigen Rahmen und zugleich effizient zu erkennen.
Funktionsweise und Grenzen des Lügendetektors
Der polygraphische Test misst mehrere körperliche Parameter wie die Atemfrequenz, die Hautleitfähigkeit und den Puls, während gezielt Fragen gestellt werden, die mit Ja oder Nein zu beantworten sind. Der Stressanstieg, den eine Person während des Lügens erlebt, zeigt sich physiologisch.
Zwar ist die Technik des Lügendetektors seit Jahrzehnten erprobt, doch es handelt sich nicht um ein magisches Wahrheitsfindungsinstrument. Emotionale Reaktionen entstehen auch aus Angst, Nervosität oder Wut, und die Werte sind kein Garant dafür, dass sie unweigerlich dem Lügen zuzuordnen sind. Personen, die mit der Funktionsweise eines Polygraphen vertraut sind, können regelmäßig Reaktionen hervorrufen, diese kontrollieren und verändern. Anerkannte Fachleute betonen damit immer wieder, dass ein Lügendetektor wichtige Hinweise liefert, aber niemals die absolute Gewissheit.
Vertrauen statt Kontrolle?
In der Lernpsychologie gilt das Vertrauen, das in eine Person gesetzt wird, als ein entscheidender Faktor für die Motivation und die Bereitschaft, Leistung zu erbringen. Die sichere Umgebung und das Gefühl, respektiert zu werden, motivieren Studierende zur Einhaltung der Regeln.
Die Kultur des Misstrauens fördert hingegen noch kreativere Täuschungsstrategien. Der Fokus der meisten Bildungseinrichtungen liegt deshalb auf der Prävention. Dazu müssen die Erwartungen und mögliche Konsequenzen klar kommuniziert werden. Das fördert die akademische Redlichkeit.