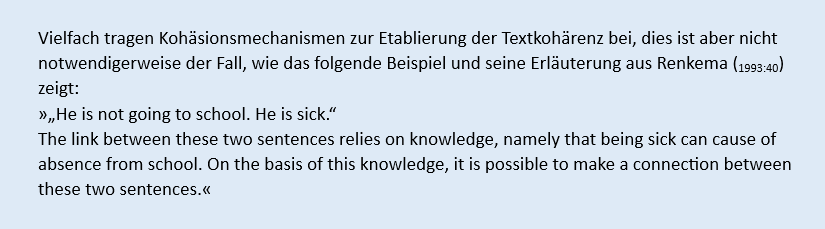Plagiate sind in der akademischen Welt ein Schreckgespenst. Viele sind schon darüber gestolpert und das teilweise erst Jahre nach dem Erlangen ihres akademischen Titels. Urheberrechtsverletzung und Betrug entsprechen nicht ethischer wissenschaftlicher Praxis und sind Straftatbestände, die auch dementsprechend geahndet werden können. Damit dir so etwas nicht passiert, haben wir dir im folgenden Beitrag alles zum Thema Plagiat zusammengestellt und zeigen dir, wie du sie vermeidest.
Definition: Plagiat
Als Plagiat bezeichnet man geistigen Diebstahl, das heißt die Übernahme fremder Gedanken in den eigenen Text, ohne sie als solche zu kennzeichnen. Man schmückt sich sozusagen mit fremden Federn, was dem Ehrenkodex der Wissenschaft widerspricht, denn richtiges Zitieren gehört zu den wichtigsten Merkmalen wissenschaftlichen Arbeitens. Der Urheber muss aber immer genannt werden.
Das Plagiat kann verschiedene Formen annehmen, nicht nur direktes Abschreiben ist ein Plagiat, sondern auch eine nicht gekennzeichnete Übersetzung oder die Übernahme einer fremden Idee ohne Literaturangabe. Beide Fälle werden als wissenschaftliches Fehlverhalten kategorisiert.
Weitere Plagiats-Definitionen
Ludwig-Maximilian-Universität (LMU)
„Von Plagiat spricht man, wenn Ideen und Worte anderer als eigene ausgegeben werden. Dabei spielt es keine Rolle, aus welcher Quelle (Buch, Zeitschrift, Zeitung, Internet usw.) die fremden Ideen und Worte stammen, ebenso wenig, ob es sich um größere oder kleinere Übernahmen handelt oder ob die Entlehnungen wörtlich oder übersetzt oder sinngemäß sind.“
Universität Zürich (ETH Zürich)
„Unter einem Plagiat versteht man die ganze oder teilweise Übernahme eines fremden Werks ohne Angabe der Quelle und des Urhebers bzw. der Urheberin.“
Formen
Hier findest du einen Überblick zu den häufigsten Arten des Plagiats:
Formen von Plagiaten
Definition
Textplagiat
Wörtliche Übernahme von Textpassagen ohne Quellenangabe.
Ideenplagiat
Paraphrasierung eines Gedankens/einer Idee. Der ursprünglich fremde
Gedanke wird durch eigenen Satzbau als Eigenleistung ausgegeben.
Die Grundidee wird dabei unverändert übernommen.
Strukturplagiat
Tritt auf, wenn jemand die organisatorische Gliederung oder das Layout
eines schriftlichen Werks kopiert oder nachahmt, ohne den tatsächlichen
Inhalt zu übernehmen.
Übersetzungsplagiat
Wenn ein Text aus einer Fremdsprache in die Zielsprache übersetzt wird,
ohne die Quelle ordnungsgemäß zu zitieren oder die Arbeit kenntlich als
Übersetzung auszuweisen.
Selbstplagiat
Tritt auf, wenn ein Autor zuvor veröffentlichte Teile seines eigenen Werks
erneut in einer neuen Veröffentlichung ohne ausreichende Kennzeichnung
oder Erläuterung wiederverwendet.
Copy-Paste-Plagiat
Text oder Inhalte aus einer fremden Quelle werden einfach kopiert und in
die eigene Arbeit eingefügt, ohne angemessene Zitate oder Verweise auf
die Quelle hinzuzufügen.
Außerdem:
- Übernahme von Metaphern, Idiomen, Sprachschöpfungen ohne Quellenangabe
- Übersetzungen aus fremdsprachlichen Werken ohne Quellenangabe
Konsequenzen
Die Konsequenzen eines Plagiats sind schwerwiegend und können auch außerhalb des akademischen Umfelds vollzogen werden, wenn es zu einer strafrechtlichen Strafe kommt:
-
Bewertung mit der schlechtesten Note
„Ungenügend“ bzw. „nicht bestanden“ und Annullierung der Prüfungsleistung. -
Prüfung kann nicht wiederholt werden
Der Betroffene wird exmatrikuliert, aufgrund des Fehlens der Prüfungsleistung. -
Aberkennung des akdemischen Titels
Auch Jahre später kann der erlangte Titel aberkannt werden und ein Studienverbor ausgesprochen werden. -
Betrug und Urheberrechtsverletzung sind Straftatbestände
Nach Urheberrechtsgesetz § 106 und Strafgesetzbuch § 263 droht sogar eine Freiheitsstrafe.
Plagiate vermeiden
Zitieren selbst ist nicht verboten, solange man sich an die Regeln hält, das Urheberrechtsgesetz erlaubt Zitieren für wissenschaftliche Zwecke, siehe §§ 51 und 63! Wozu also betrügen und die Konsequenzen tragen, wenn man einfach nur ordnungsgemäß zitieren und so fremde Gedanken ganz problemlos integrieren kann?
Doch wie lässt sich nun ein Plagiat vermeiden? Zunächst muss man genau wissen, ab wann man von einem Plagiat spricht bzw. wo die Grauzone beginnt. Plagiat-Tester können dabei helfen. Die folgenden Beispiele sollen zusätzlich aufzeigen, wo die Grenze von gekennzeichnetem Zitat und Plagiat erreicht ist.
Wenn du mehr dazu wissen möchtest, sehe dir unseren Beitrag über das Vermeiden von Plagiaten an:
Beispiele von Plagiaten und korrektem wissenschaftlichem Arbeiten
Originaltext
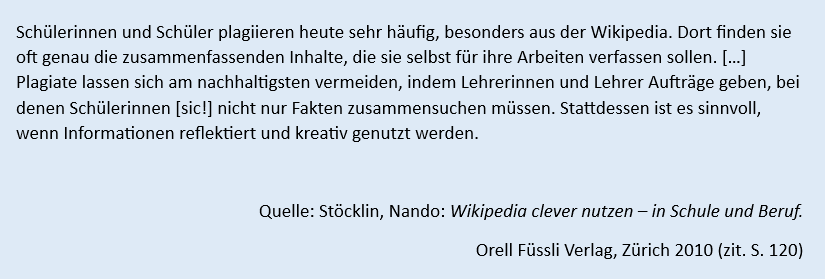
Beispiel 1
Wörtliches Zitat, vollständig gekennzeichnete Quelle angegeben.
Sinngemäßes Zitat, aber nicht paraphrasiert; bzw. wörtliches Zitat, aber nicht korrekt gekennzeichnet.
Hinweis: Diese Verwendungsweise ist nicht korrekt, obwohl die Quelle angegeben wurde.
Beispiel 2
Sinngemäß zitiert, korrekt paraphrasiert, durch Konjunktiv I („verleite“) und „vgl.“ verdeutlicht, Quelle angegeben.
Hinweis: Fachtermini wie „Fakten“ oder „Plagiat/plagiieren“ oder Namen wie „Wikipedia“ werden beim Paraphrasieren nicht ersetzt.
Verschleiertes Plagiat, nicht als Zitat gekennzeichnet, Quelle nicht angegeben.
Beispiel 3
Halb sinngemäß, halb wörtliches Zitat, korrekt gekennzeichnet, Quelle angegeben, in den Satz integriert.
Übersetzungsplagiat, nicht als Zitat erkennbar, Quelle nicht angegeben,
Beispiel 4
Sinngemäßes Zitat, Quelle als Beispiel für eine bestimmte Einschätzung/Denkrichtung angegeben.
Hinweis: Hier wäre eine zweite Quellenangabe wünschenswert, um zu zeigen, dass es sich nicht nur um eine Einzelmeinung handelt.
Totalplagiat, eins zu ein übernommen, ohne Kennzeichnung als Zitat, ohne Quellenangabe.
Beispiel 1
Erläuterungen
Übersetzung des Originals durch den Autor, weiterhin direktes Zitat: Korrekt!
ABER: Es muss angegeben werden, dass es eine Übersetzung ist und wer übersetzt hat!
Beispiel 2
Erläuterungen
Hier wird schon die Grauzone zum Plagiat erreicht: Nur der Beispielsatz wird als direktes Zitat gekennzeichnet, weiterhin wird paraphrasiert ohne Quellenangabe: Selbst wenn sie identisch ist, muss sie bei der Paraphrase angegeben werden.
Beispiel 3
Erläuterungen
Dies geht noch einen Schritt weiter als Zitierform 2: Die Übersetzung aus dem Original ist korrekt zitiert, aber bei der Paraphrase wird keine Quelle angegeben, nicht einmal ein Name wird genannt. Es ist unklar, ob es sich um fremde Gedanken oder eine eigene Interpretation handelt (und hier ist es fremdes Gedankengut)!
Beispiel 4
Erläuterungen
Der Beispielsatz ist schon nicht als Zitat gekennzeichnet, da die Quellenangabe fehlt; auch die Paraphrase ist nicht richtig zitiert, da die Seitenangabe fehlt.
Beispiel 5
Erläuterungen
Totalplagiat: keine Quellenangabe nach dem direkten Zitat und auch die Paraphrase ist nicht gekennzeichnet.
Mehr Infos zum richtigen Zitieren findest du in unserem Blog. Wir haben Beiträge zu allen Arten von Zitierformen in wissenschaftlichen Arbeiten inklusive Beispielen für die richtige Anwendung.
Video zum Thema „Plagiat“
Unsere Doktorandin Bianca erklärt dir in nur 5 Minuten was ein Plagiat ist und wie du es in deiner Bachelorarbeit oder Masterarbeit vermeidest.
Fazit
- Die Übernahme fremder Gedanken und Ideen, ohne diese zu kennzeichnen, bezeichnet man als Plagiat; man schmückt sich sozusagen mit fremden Federn.
- Es gibt verschiedene Arten des Plagiierens: Textplagiat, Ideenplagiat, Übersetzung aus fremdsprachlichen Werken, Übernahme von Metaphern/Idiomen und Zitatsplagiat.
- Um Plagiate zu finden, gibt es spezielle Software, welche den eingereichten Text mit sämtlichen Texten im World Wide Web abgleicht.
- Plagiieren hat schwerwiegende Konsequenzen: Titel können aberkannt werden, die Prüfung nicht wiederholt, aber mit der schlechtesten Note bewertet werden UND, da es als Betrug zählt, liegt hier sogar ein Straftatbestand vor.
- Zitieren ist keineswegs verboten, solange man sich an die Regeln hält und weiß, ab wann die Grauzone beginnt, dann lassen sich Plagiate ganz einfach vermeiden.
Häufig gestellte Fragen
Unter dem Begriff Plagiat versteht man, die Übernahme von fremden geistigen Eigentums ohne es zu kennzeichnen. Achte deshalb genau darauf, dass du richtig zitierst. Denn ein Plagiat führt dazu, dass du deine wissenschaftliche Arbeit nicht bestehst.
Als Plagiat gilt alles, was du aus einem anderen Text übernommen hast ohne es zu kennzeichnen. Dementsprechend wichtig ist es, dass du bei deiner wissenschaftlichen Arbeit eine exakte Literaturrecherche betreibst. Ansonsten wirst du deine wissenschaftliche Arbeit auf Grund eines Plagiats nicht bestehen.
Erfahrene Dozenten sind geübt darin Plagiate zu erkennen, da diese bekannte Sekundärliteratur ihres Fachbereiches sehr gut kennen. Mittlerweile nutzen Universitäten zusätzlich immer häufiger Plagiatsprüfungen um ein Plagiat zu erkennen. Dabei werden Schriftstücke mit Datenbanken aus dem Internet abgeglichen um Ähnlichkeiten oder Unstimmigkeiten zu erkennen.
Nein, denn selbst wenn du dich am Aufbau einer anderen wissenschaftlichen Arbeit orientierst, gilt das als Plagiat. Du musst deshalb darauf achten, dass sich nicht nur der Inhalt, sondern auch deine Gliederung von themenverwandten Arbeiten unterscheidet.
TIPP: Gehe auf Nummer sicher und nutze die kostenlose Plagiatsprüfung, damit du ein Plagiat vermeidest.
Paraphrasieren bedeutet fremde Ideen in deinen eigenen Worten wiederzugeben. Dementsprechend handelt es sich nicht um ein Plagiat, wenn du paraphrasierst. Allerdings ist es dabei wichtig, dass du diese Textstellen kennzeichnest. Achte darauf, dass du dich an die Zitierregeln hältst damit du keine Probleme mit Plagiatsvorwürfen bekommst.